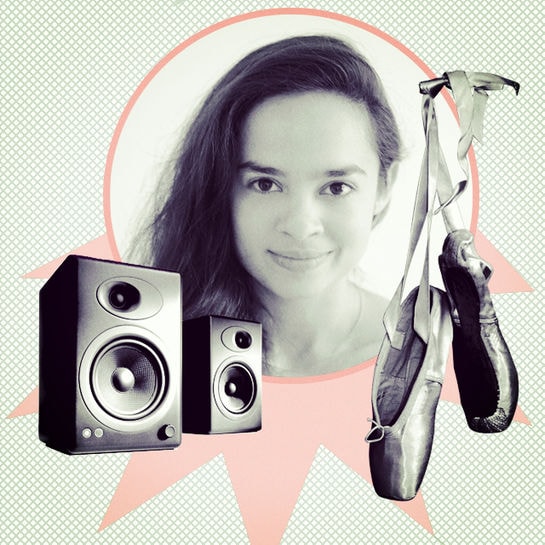- • Startseite
- • Wie viel verdient ...?
-
•
Wie viel verdient eine Tänzerin?
Die häufigste Frage auf Partys
Wenn ich auf Partys erzähle, dass ich als Tänzerin und Choreographin arbeite, erwarten mich immer wieder dieselben drei nervigen Fragen. Erstens: Ob ich wirklich einen Spagat könnte. Zweitens: Ob ich vom Tanzen überhaupt leben kann und drittens – und das finde ich erstaunlich – wie viel ich denn überhaupt verdiene. Das deutsche Tabu-Thema „Einkommen” trifft auf Künstler offenbar nicht zu. Deswegen habe ich häufig den Eindruck, für viele zählt das gar nicht als Beruf, das „Tänzer-sein”.
Womit ich fertig werden muss
Viele denken vermutlich, wir leben unseren Kindheitstraum. Das wissen sie aus Filmen wie „Black Swan" oder „Billy Elliott". Sie denken, wir sind alle bildschön und vom Rampenlicht besessen. Tanzen in den prächtigsten Theaterhäusern der Welt und werden von unseren Zuschauern mit Applaus belohnt. Es hat keine zwei Semester gedauert, bis ich begriff, dass die Realität ganz anders ist. Die Vorstellung ist ungefähr so wahr, wie die, dass jeder Profiboxer das Leben von Rocky führt.
In echt ist die Konkurrenz global und jede Stelle hart umkämpft. Die prächtigen Bühnen sind nicht gerade selten eingestaubte Fabrikhallen, in denen oft mehr leere als besetzte Campingstühle für die Zuschauer stehen. Es ist üblich, am Anfang seiner Karriere sehr schlecht oder sogar unbezahlte Jobs anzunehmen. Und auch noch vier Jahre nach meinem Studium kenne ich gerade mal eine Handvoll Menschen, die in einer Company tanzen – also ein regelmäßiges Einkommen haben und über ihren Arbeitgeber krankenversichert sind. Ich hab sehr schnell verstanden: Tanzen und Überleben passen eigentlich gar nicht zusammen.
Besonders weh tut es aber dann, wenn eine Produktion zwar über genügend Fördermittel verfügt, diese aber lieber in neueste Sound- und Lichttechnik investiert als in unsere Bezahlung. Das ist dann jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man als Tänzerin für die Produktion mehrere Monate täglich acht Stunden harte Arbeit reinsteckt. Und letztlich dann auch noch wochenlang auf der Bühne steht. Tänzer und Künstler aller Art brauchen also unbedingt ein gesundes Selbstwertgefühl. Damit das Leid die Leidenschaft nie überwiegt.
Wie ich da hingekommen bin
Meine klassische Ballettausbildung habe ich erst mit 14 Jahren begonnen. Was untypisch ist. Fürs Tanzen wird man geboren, beginnt oft mit sechs Jahren schon seine klassische Ausbildung. Trotz viermal in der Woche Training habe ich mein Abitur abgeschlossen. Eine berufliche Alternative gab es für mich nie. Ich glaube, anders funktioniert ein Künstlerleben auch nicht. Während meines Studiums an der Londoner Company Dance School wurde es für mich erstrebenswerter, mein eigenes Ding zu machen, als im Haifischbecken um schlecht bezahlte Jobs zu ringen. Als mir die London Contemporary Dance School also einen voll-finanzierten Master anbot, lehnte ich ab, packte meinen Koffer und zog nach Berlin. Ich hatte das rasante Schulleben und die Tanzindustrie satt. Ich wollte nicht unter enormen Zeitdruck eine Tour planen müssen und mir stattdessen Zeit für Recherche und Projekte nehmen. Um wirklich kreativ arbeiten zu können.
Vier Jahre später bereue ich nichts. Wie erwartet, durchlebte ich harte Zeiten, in denen ich mir am Monatsende ganz genau überlegen musste, was in den Einkaufswagen kommt. Schließlich gründete ich ein Kollektiv aus neun Tänzern, mit denen ich ein Studio eingerichtet habe. Über die Organisation “artisania” sind wir weltweit mit Tänzern verschiedenster Professur und Stilen vernetzt; unsere Projekte sind sehr international. Ich bin sehr stolz auf das, was ich mir in Berlin aufgebaut habe.
Die jetzt-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von vimeo angereichert
Um deine Daten zu schützen, wurde er nicht ohne deine Zustimmung geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von vimeo angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit findest du unter www.swmh-datenschutz.de/jetzt.
Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil du dem zugestimmt hast.
Was der Job mit meinem Privatleben macht
Für die Jobs als Tänzerin musste ich immer viel um die Welt jetten. Es war zeitweise stressig, dafür aber aufregend. Mir hat dieses abwechslungsreiche Leben sehr gefallen. Als Choreographin wird man dann sesshafter, da viele Aufträge aus Berlin kommen. Vermutlich freut sich mein Freund zwar über meine Sesshaftigkeit, dass ich vorher für längere Zeit oft die Stadt verlassen habe, hat unsere Beziehung trotzdem nie belastet. Vielleicht hat er als Musiker mehr Verständnis für ein Künstlerleben, als jemand mit einem durchgetakteten Alltag. Dass Künstler ihr Glück in der Liebe nur mit Künstlern finden können, halte ich aber für einen Mythos.
Mein Berufsalltag
Es hängt natürlich davon ab, ob ich als Choreographin oder Tänzerin arbeite. Derzeit leite ich als Choreographin eine Produktion. Das heißt, ich stehe täglich gegen 8 Uhr auf und setzte mich aufs Fahrrad Richtung Neukölln. Dort erwartet mich ein zweistündiges Profitraining. Nach einer kurzen Mittagspause bin ich dann meistens im Studio und arbeite meine eigenen Choreographien aus. Ist auch das geschafft, folgt der eher unangenehme Part meines Jobs: Ich muss mich um den mühsamen Bürokram kümmern. Ich akquiriere also Fördermittel, buche Veranstaltungsräume und plane Abläufe, Proben und Termine für die beteiligten Tänzer. Wenn wir schon mitten in den Proben stecken, fahre ich danach wieder ins Studio, um mit den Tänzern das Stück einzustudieren. Ich nehme mir den Feierabend immer für 19 Uhr vor – das klappt allerdings nur selten!
Was ich verdiene
Im schlimmsten Fall verdiene ich 300 Euro und im besten Fall über 1000 Euro Netto. Sehr oft sind es aber nur 500 Euro, die ich am Monatsende habe. Deswegen unterstützt meine Mutter mich gelegentlich finanziell. Geht nichts mehr, muss ich mich mit Minijobs über Wasser halten. Hat man sich einmal daran gewöhnt, kann man so überleben. Obwohl meine Arbeitsbedingungen also katastrophal sind, ist mir das die Sache wert!