- • Startseite
- • Nachbarschaft
-
•
Gute Nachbarschaft ist Trend. Aber was ist daran eigentlich so toll?
Als ich in meine Wohnung zog, hatte ich mir fest vorgenommen, einen Kuchen zu backen und damit bei meinen Nachbarn zu klingeln, um mich vorzustellen. Gleich am Tag nach dem Einzug wollte ich es machen, um ja keine Zeit zu verlieren und jeden gleich mit Namen im Treppenhaus grüßen zu können. Dann wurde der neue Kühlschrank später als geplant geliefert, und die Zutaten, die ich gekauft hatte, verdarben in der Julihitze. Ich verschob den Plan um ein paar Tage, kaufte noch mal alles ein, aber dann musste ich überraschend verreisen. Egal, dachte ich, machst du’s halt nächstes Wochenende, unter der Woche ist eh niemand zuhause, und Kuchen isst man doch sowieso am besten Sonntagnachmittags.
Das ist jetzt über ein Jahr her. Die Himbeeren für die Obstfüllung liegen immer noch im Tiefkühlfach, und die Menschen, mit denen ich Wand an Wand wohne, sehe ich nur alle paar Wochen, wenn sie ein Paket von mir angenommen haben oder ich eins von ihnen. Ich habe so gut wie keinen Kontakt zu meinen Nachbarn – und das gefällt mir.
Wenn ich im Sommer auf meinem Balkon sitze und das Gesicht in die Sonne halte, kann ich das nur so lange genießen, bis ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung registriere. Dann weiß ich, die Nachbarin zur Rechten gießt ihre Blumen, und wenn ich mich nicht ganz schnell schlafend stelle, werde ich in ein nicht enden wollendes Gespräch darüber verwickelt, wie man Olivenbäume heil durch den Berliner Winter bringt, wobei wir auf eine absurde Weise wie zwei Schwerhörige SEHR LAUT UND DEUTLICH reden, um die fünf Meter Luftlinie zwischen uns zu überbrücken.
Im Netz boomen Portale wie nebenan.de und nextdoor.com
My home is my Schneckenhaus. Anders, als ich mir das ursprünglich vorgenommen hatte, will ich meine Nachbarn eigentlich gar nicht kennen. Allerdings bewege ich mich damit komplett gegen den Trend. Im Netz boomen Portale wie nebenan.de und nextdoor.com, auf denen sich Nutzer für ihre jeweiligen Stadtviertel registrieren und online mit ihren Nachbarn vernetzen können. Und auch in meinem Hausflur hing jetzt schon zum zweiten Mal ein hochprofessionell gestalteter Flyer der lokalen Nachbarschaftsinitiative, der zu einem „Nachbarschaftstag“ im Kulturzentrum um die Ecke einlud. Es gibt Kiezgespräche, Kiezspaziergänge, Kiezflohmärkte, Kiezpicknicke. Als wollten plötzlich alle mit ihren Nachbarn nicht nur bekannt, sondern befreundet sein. Warum eigentlich?


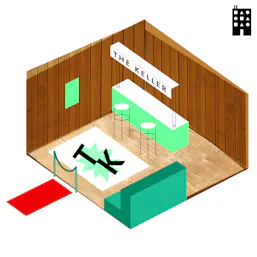



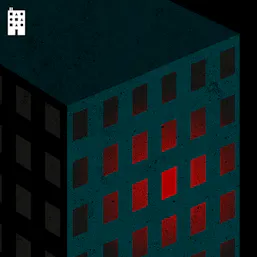

Die Soziologin und Stadtplanerin Franziska Schreiber arbeitet für die Berliner Denkfabrik adelphi und forscht zum Thema Nachbarschaft im digitalen Zeitalter. Meine Beobachtung teilt sie nur bedingt: „Ich glaube, Nachbarschaft hat schon immer eine große Rolle gespielt. Nur haben wir jetzt die Werkzeuge, die es besonders einfach machen, auch in Großstädten mit unseren Nachbarn in Kontakt zu treten.“ Gemeint sind digitale Plattformen, die es vor allem in anonymen Metroplen einfach machen, zu erfahren, wer eigentlich so um einen herum wohnt, wo es die besten Wochenmärkte, Arztpraxen, Joggingstrecken in der näheren Umgebung gibt – und was man sonst noch alles gemeinsam hat. Oder haben könnte. Schreiber erzählt etwa von einer Hausgemeinschaft, die sich per digitalem Nachbarschaftstreff vernetzte und auf einen gemeinsamen Werkraum im Keller einigte, damit sich nicht jeder einen Werkzeugkasten kaufen müsse.
Wenn ich meine Nachbarschaft entdecken soll, heißt das im Umkehrschluss: Meine Nachbarschaft entdeckt auch mich
Dinge miteinander teilen, die man selten braucht und die für einen alleine zu teuer wären oder zu viel Platz beanspruchen würden – super Sache. Aber ist nicht gerade das schönste am Erwachsenwerden und Alleinewohnen, dass man endlich den Rückzugsraum hat, den man früher nicht haben konnte, zu dem nur man selbst einen Schlüssel hat? Wenn ich meine Nachbarschaft entdecken soll, heißt das im Umkehrschluss: Meine Nachbarschaft entdeckt auch mich. Und zwar unwiderruflich.
Wir wissen, wo du wohnst: Für viele scheint genau das attraktiv zu sein. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen hat Franziska Schreiber eine Studie zu Nachbarschaftsportalen in mehreren deutschen Wohngebieten durchgeführt, von Stadt bis Land und Ost bis West. Dabei ist ihr aufgefallen, dass die User im Schnitt Mitte 40 oder älter sind. Ein Grund dafür, warum Ältere solche Portale verstärkt nutzen, liegt auf der Hand: „Je eingeschränkter man in seiner Mobilität ist, desto eher orientiert man sich an der näheren Umgebung“, sagt Schreiber. Das könnten ältere Menschen sein, aber auch Familien mit kleinen Kindern. „Man schaut dann, dass man sein Sozialleben eher in die unmittelbare Nähe verlagert, hin zu Menschen in ähnlichen Lebenslagen“.
Junge Menschen interessierten sich dagegen eher für Stadtteilblogs und lokale Facebook-Gruppen, erklärt die Soziologin. Irgendwie logisch: Wir sind es gewöhnt, dass wir für jedes unserer Bedürfnisse eine Plattform haben. Von „Ich hätte jetzt gern“ bis zur Erfüllung des jeweiligen Wunschs ist es nur ein Klick. Wer neue Klamotten braucht, geht auf Zalando, wer Pizza will, geht auf Deliveroo, wer Sex sucht, auf Tinder. Und wem langweilig ist, wer sich nicht alleine fühlen will oder ganz schnell eine Bohrmaschine braucht, der geht auf Facebook und sucht sich den Aspekt von Nachbarschaft, der gerade passt: Sachen tauschen, verkaufen oder verschenken. Oder Leute finden, die Lust haben, einmal in der Woche gemeinsam bouldern zu gehen.
Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, vor die Tür und von dieser zur nächsten zu gehen, um wildfremde Menschen um etwas zu bitten
Dass wir Jüngeren nicht so wild darauf sind, unsere Nachbarn im Allgemeinen kennenzulernen, liegt vielleicht auch daran, dass wir im Zeitalter der absoluten Berechenbarkeit leben. Unangemeldete Besuche gelten angesichts von weltweit 1,5 Milliarden WhatsApp-Nutzern als Horrorszenario (man denke nur an die erfolgreiche StudiVZ-Gruppe „Ich stelle mich tot, wenn es an der Tür klingelt“). Man will sich nebenan nur mal einen Topf borgen und findet die große Liebe: Vor 20 Jahren reichte das für einen abend- und herzerfüllenden Kinofilm („In the Mood for Love“ von Wong Kar-Wai zum Beispiel ist wirklich sehr, sehr schön). Aber 2018 sind wir so sehr darauf gepolt, selbst alles zu schaffen. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, vor die Tür und von dieser zur nächsten zu gehen, um wildfremde Menschen um etwas zu bitten. Denn was, wenn dahinter jemand wohnt, mit dem wir nichts als angestrengten Smalltalk zustande kriegen, den wir dann bei jeder Begegnung wiederholen müssen, weil man so eine Bekanntschaft ja nicht einfach rückgängig machen kann? Oder mit dem wir uns plötzlich unschön auseinandersetzen müssten?
Politische Debatten, auch lokalpolitische, spielen auf den digitalen Nachbarschaftsportalen so gut wie gar keine Rolle, hat Franziska Schreiber festgestellt. „Ein Grund ist, dass die Menschen das überhaupt nicht wollen. Kontroverse Themen werden bewusst ausgespart, um neu geknüpfte Kontakte nicht zu gefährden.“ Irgendwie gehören die Nachbarn also mit zum Schneckenhaus. Ein Rückzug unter das miteinander geteilte Dach, wo man den großen globalen Themen, die ständig auf uns einprasseln, wenn überhaupt im Kleinen begegnet. Bei der Diskussion über die gemeinsam abonnierte Zeitung etwa oder über die Frage, wie bio die Gemüsekiste ist, die eine Hausgemeinschaft regelmäßig vom Bauern geliefert bekommt.
Wer sich unter seinen Nachbarn nicht wohlfühlt, hat ein höheres Risiko, zu erkranken
Mit wem und neben wem wir leben, bestimmt weit mehr als nur unsere Vorliebe oder Abneigung gegenüber Smalltalk. Dass Soziologen das Wohnumfeld für den weiteren Lebensweg mitverantwortlich machen, ist längst bekannt. Forscher haben aber auch herausgefunden, dass ein Zusammenhang zwischen Depressionen und Nachbarschaft besteht. Wer sich unter seinen Nachbarn nicht wohlfühlt, hat ein höheres Risiko, zu erkranken. In dieser Hinsicht habe ich Glück: Ich lebe in einer Gegend, in der Berlin so unaufgeregt vielfältig ist wie nirgends sonst. Und um den Grünstreifen in meiner Straße kümmert sich nicht etwa die Stadtverwaltung, sondern dankenswerterweise die Nachbarschaftsinitiative, die zweimal im Jahr ein gemeinsames Gärtnern veranstaltet. Da würde ich tatsächlich gerne mal mitmachen.
Sind meine Nachbarn also irgendwo doch meine Nächsten? Nein, und sie sollen es auch nicht werden. Mein Plan, einen Kuchen zu backen, ist damals nicht allein aus Pflichtgefühl heraus entstanden. Ich wollte gerne diese Worte aussprechen: „Hallo, ich bin die Neue aus dem Vorderhaus.“ Eine Aussage, die ich auch an mich selbst gerichtet hätte. Die Botschaft, angekommen zu sein – zuhause.
Ich lebe jetzt hier, ich bin eine von euch: Dem Gemeinschaftsgefühl einer Nachbarschaft kann man sich nicht entziehen, auch wenn man eigentlich gar keine Lust auf Begegnungen hat. Ich erinnere mich noch gut, wie ich mir mit 15 die Haare hennarot gefärbt hatte und dann bei unserer 90-jährigen Nachbarin gegenüber klingeln musste, um ihr irgendetwas von meiner Mutter zu bringen. Sie warf einen kurzen Blick auf meine Frisur, hob ihren knotigen Finger und sagte: „Aber wenn du sie dir grün färbst, dann gehörst du nicht mehr in die Triftstraße.“ Meine Eltern haben noch jahrelang darüber gelacht, wie sauer ich zurückkam, und natürlich war das eine völlig bescheuerte Aussage. Aber so eilig ich es schon damals hatte, aus Niedersachsen möglichst weit weg zu ziehen: Sie hatte mir einen Stich versetzt. Das war doch mein Zuhause, diese Straße. Ich wollte nicht verstoßen werden.
Stadtteilblogs sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen
Daran hat sich nichts geändert, auch wenn unsere Generation ihr Identifikationsbedürfnis anders befriedigt als früher, wo das, was die Nachbarn über einen dachten, schwerer wog als das Grundgesetz. Stadtteilblogs sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen, sagt Franziska Schreiber: „Man weiß etwas, das andere nicht wissen.“ Die besten Cafés zum Frühstücken, die Wege mit den wenigsten Pfützen im Park um die Ecke.
Tatsächlich finde ich meine Nachbarschaft so am schönsten, wie sie online gelebt wird: Aus einiger Distanz, die man im Bedarfsfall individuell verringern kann, ohne dafür ein ganztägiges Event mit Gruppenzwang veranstalten zu müssen. Als neulich eine Frau auf Facebook auf die Pinnwand meines Stadtteilblogs die verzweifelte Frage postete, ob jemand einen Schokonikolaus für ihr Kind organisieren könne, weil sie es nicht mehr zum Einkaufen schaffte, bekam sie sofort 10 Angebote (plus einen blöden Kommentar, den die anderen aber sofort niedermachten), und damit hatte es sich auch wieder. Um einander zu helfen, braucht es also keine Dorfgemeinschafts-Romantisierung einer Postleitzahl. Nachbarn sind nicht die neuen besten Freunde. Sondern einfach Nachbarn.

