- • Startseite
- • Liebe und Beziehung
-
•
Partner im Gefängnis
Nina und Marc
Marc kam im Blaumann zum Netto, er hatte was Verwegenes; Nina saß an der Kasse, weil sie dort jobbte, Blickkontakt, schönes Gesicht, wow. Nach der Arbeit wartete er romantisch auf dem Parkplatz, überraschte sie. Sie gingen sie spazieren. Einmal sagte Marc, ich muss noch weg, und Nina so, wohin? „Termin beim Bewährungshelfer“, meinte Marc. Konnte ja niemand ahnen, dass das Verwegene an ihm einen realen Hintergrund hatte. Marc erzählte wenig. „Er hat immer gesagt: Was ich getan habe, war vor unserer Zeit“, sagt Nina, heute 30. „Natürlich willst du das glauben, wenn du verliebt bist.“
Die meisten Angehörigen von Gefängnisinsassen in Deutschland sind Frauen. Von 62.194 Inhaftierten in Deutschland sind nur 3.502 weiblich. In der Sicherungsverwahrung, wo Verurteilte landen, die besonders schwere Straftaten begangen haben und diese Taten jederzeit wieder begehen könnten, liegt das Verhältnis bei 551 zu 2.
Wenn Menschen ins Gefängnis kommen, hinterlassen sie zu Hause eine Lücke. Sie sind schwieriger zu erreichen, man kann sie nur noch mit Ankündigung besuchen, es gibt oft ein Kontingent; darauf kommen die Fahrzeiten zum Gefängnis, die begrenzte Dauer der Besuche (zwischen einer und vier Stunden), ansonsten helfen nur: Brief, Telefon, in manchen Gefängnissen auch Mail.
Die Besuche sind überwacht, hinter Glas, fast immer akustisch, manchmal per Video. Im Prinzip: ein Aquarium. Sie finden in Gruppenräumen statt, und manchmal ist das Gemurmel so laut, dass es wiederum selbst zum Gespräch wird. Wenn Menschen ins Gefängnis kommen, werden die Angehörigen ein Stück weit mitinhaftiert.
Als es zur Gerichtsverhandlung kam, lagen die Dinge zum ersten Mal auf dem Tisch: Diebstähle, Einbrüche, Fahren ohne Führerschein, Fahrerflucht und Körperverletzung. Zweieinhalb Jahre Gefängnis, sagte der Richter, und Nina meinte hinterher zu Marc, sie werde warten, wird schon. Marc hoffte das auch.
Wer nicht brandgefährlich ist und fliehen will, Spuren verwischt oder Zeugen einschüchtert, der wird in Deutschland nach einer Straftat nicht automatisch von der Polizei abgeholt. Selbststellen nennt man das. Selbststellen geht so: Man bekommt ein strenges Schreiben mit imposantem Briefkopf und z.B. Bundeslandwappen, und auf dem strengen Schreiben stehen ein Ort, ein Datum und eine Uhrzeit. Irgendwie dachten Marc und Nina, das strenge Schreiben werde schon nicht so streng zu ihnen sein. Sie ließen das Datum verstreichen und führten ihr Leben fort: fuhren in den Familien-Urlaub, in die Berge.
Das strenge Schreiben hatte sie natürlich nicht vergessen, es kam wieder, etwas strenger diesmal, und der Himmel war grau und es war morgens um sieben, und das Schreiben lag in der Hand eines Polizisten. Die Cops hämmerten gegen die Tür, klingelten Sturm; Männer wie große, schwarze Batterien. Nina und Marc kauerten auf dem Sofa. Die Polizei suchte ihn jetzt. Sie kamen zu Marcs Arbeitsstelle. Sie riefen an. Irgendwann wurde der Druck zu groß; Marc stellte sich. Und für Nina begann das Warten.
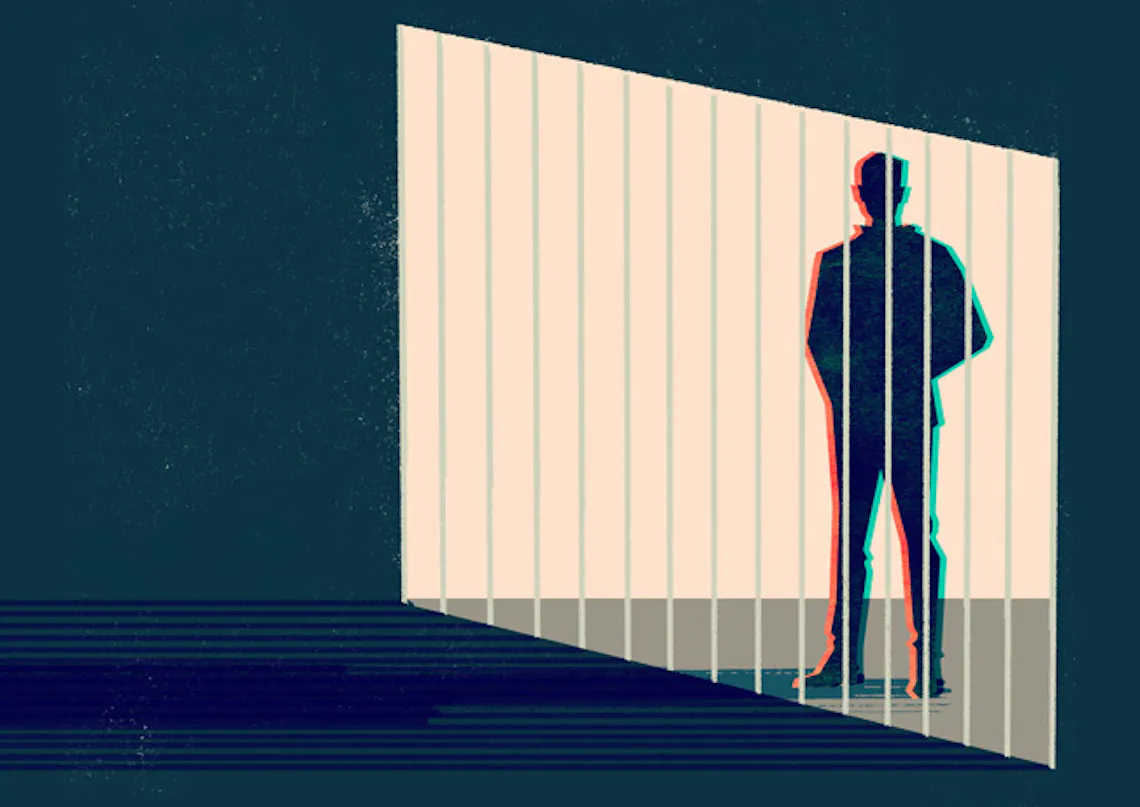
Marie und Chris
Paddel ist eigentlich das richtige Wort. Chris war immer gedankenlos gewesen, was seine Papiere anging. Marie hatte Chris im Internet kennengelernt, beide verstanden sich gut. Er war liebevoll, seriös, verdiente gutes Geld und arbeitete viel. Marie wollte keinen weiteren Mann, um den sie sich hätte kümmern müssen. Er zog für sie über 500 Kilometer weit weg von seiner Heimat und fing bei einer Baufirma an. Mit ihren Eltern verstand er sich gut.
Klar, da waren Dinge. „Er erzählte mir, dass er ein halbes Jahr gesessen hatte“, sagt Marie, heute auch 30: „Diebstahl und Urkundenfälschung.“ Eine Bewährung lief noch. Marie dachte, das sei bald vorbei, das gehe vorbei. Haft kannte sie schon aus der Familie. „Okay, er hat Scheiße gebaut, aber er hat dafür gesessen“, meinte sie zu sich. Hauptsache, er hat daraus seine Lehren gezogen. Weiter kümmerte es sie nicht.
Ein Verfahren war noch offen. Chris hatte ein Fahrzeug gemietet, für einen Freund, und dann hatte er etwas unterschrieben. Ausgerechnet er. Der Freund bezahlte nicht und brachte den Wagen auch nicht zurück. Anklage: Betrug und Urkundenfälschung. Marie und Chris bekamen eine Vorladung, Chris meldete sich krank zur Verhandlung. Es kam keine Antwort zurück. Beide dachten: Na gut, okay. Sie haben es akzeptiert. Aber hatten sie nicht.
Drei Monate, nachdem ihre Tochter geboren wurde, alles war unaufgeräumt, Marie meint, sie habe ausgesehen, wie gerade aus einer Hartz-IV-Sendung entsprungen, da klingelte es. Sie holten ihn zu sich. Es war früh morgens; Chris wollte gerade zur Arbeit gehen.
Danach saß Marie allein auf dem Sofa, das Kleinkind im Arm und dachte: das ist alles ganz schlimm. „Für mich brach die Welt zusammen. Ich habe noch versucht, seinen Anwalt zu kontaktieren, weil ich nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Chris konnte sich plötzlich nicht mehr äußern.“ Sie brachten ihn in die Untersuchungshaft. In der Nähe. Untersuchungshaft meint: kein Kontakt bis zur Verhandlung.
Marie griff trotzdem zum Telefon. Anstalten geben telefonisch aber keine Informationen raus. Sie dürften einem „Fremden“ nicht sagen, wer in der Anstalt sitzt. Datenschutz. Da könne ja jeder kommen. Nur die Eltern erfuhren es. Marie war „nur eine Freundin“.
Sechs Monate hörte sie nichts von Chris. Als die Verhandlung vorbei war, kam er zurück. Freispruch. Marie ist nie böse gewesen. Enttäuscht. Ja, enttäuscht ist das richtige Wort. Mit seinen Papieren ist Chris immer paddelig gewesen. „Er sagte mir und unserer kleinen Tochter: Das wird nicht wieder passieren“, sagt Marie. Und hätte er sich vernünftig um seine Papiere gekümmert, wäre das wohl auch so gewesen.
Nina und Marc
Dass etwas im Begriff war, sich zu ändern, bemerkte Nina beim ersten Treffen im Gefängnis. Marc, der immer schon ein Alpha-Tier gewesen war, beobachtete die anderen Häftlinge im Besuchsraum genau, wie ein Tiger im Tigerkäfig. „Er wollte der Coole sein, der Starke“, meint Nina. „Ich habe gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Dass dieses Umfeld ihn beeinflusst.“
Für die Haftanstalten ist es immer Abwägungssache: Einerseits sollen die Inhaftierten nahe ihres Wohnortes bleiben, sie sollen ihr Umfeld haben und ihre Familien sehen, denn die Familien sind der Garant für die Resozialisierung. Sie fangen auf, was Gefängnisse nicht leisten können. Wärme, Nähe, Geborgenheit. Anstalten versuchen viel: Spielsachen und Besuchskontingente für die Kinder, die frei sind und nicht auf das monatliche Kontingent einzahlen, und „Langzeit-Besuchszimmer“. Darin steht ein Bett, man kann darin Sex haben. Immer wieder sagen Frauen von Häftlingen, dass sie das Zimmer eher meiden, weil da in der Mitte dieses Bett steht, das sie unterschwellig auffordert. Manche Anstalten haben deswegen nur noch eine neutrale Couch, die man zum Schlafsofa ausklappen kann.
Aber nicht jeder hat das Recht auf ein „Langzeit-Besuchszimmer“. Denn andererseits wollen die Anstalten auch Prostitution verhindern. Und das kommt vor. In der Regel müssen Paare also nachweisen, dass sie schon vor dem Gefängnis zusammengelebt haben, was zwar erst mal unfair und willkürlich erscheint, aber die Anstalten wollen ihre Häftlinge auch vor Enttäuschungen bewahren. Denn was, wenn ein Inhaftierter per Brief eine Frau kennenlernt, die ihm falsche Hoffnung macht? Liebeskummer im Knast, wenn man nicht raus kann, kann toxisch sein.
Nina hatte noch Glück. „Die Besuchstermine waren unkompliziert zu machen, wo Marc war. Die Tage waren fast immer frei. Da habe ich schon anderes gehört“, erzählt sie. Trotzdem: Man fühle sich permanent beobachtet. Gürtel ausziehen. Abgetastet werden. Aufgerufen werden. Nicht alle Anstalten wollen, dass man Händchen hält oder sich küsst. „Die Privatsphäre“, sagt Nina, „ist natürlich stark eingeschränkt. Und das bedeutet, man kann sich nie so unterhalten, wie man es draußen tun würde.“
Dann kam die gute Nachricht. Marc bekam einen Platz angeboten, in einem Programm, das sehr junge Inhaftierte draußen resozialisiert; vor den Mauern. So mit harter Arbeit und frühem Aufstehen. Das ist eine Chance für uns beide, meinte Nina, und als Marc den Platz wirklich bekam, folgte die Ernüchterung. Sechs Monate habe sie daraufhin, abgesehen von Briefen, keinen Kontakt zu Marc gehabt. „Das war ein Hammerschlag“, sagt Nina.
Denn: zu viel Ablenkung ist auch unerwünscht. Die Anstalten gucken dann streng und betonen, es gehe hier auch noch ums Bestrafen. Und eine Strafe bedeute Entbehrungen. Der Inhaftierte soll sich auf seine Tat und deren Aufarbeitung fokussieren. Auch Häftlinge selbst haben die Möglichkeit, ihre Kontakte einzuschränken. Wenn sie zum Beispiel nicht wollen, dass sich „alte Freunde“ noch melden. Besuchszeiten kann man nur vereinbaren, indem man sich auf eine Liste setzen lässt, der Inhaftierte gibt die Namen dann frei. Deshalb kann nicht automatisch jeder jeden besuchen.
Einmal durften Marcs Eltern kommen. Zeugnis. Marc hatte in der neuen Maßnahme die Realschule bestanden. Nina ist heute noch sauer, dass sie nicht mitkommen durfte. Dass man sie aussperrte, an so einem Tag, der doch wichtig war. Aber Eltern sind eben Eltern. Und du bist nur „die Freundin“.
Nina konnte nicht viel tun. Marc nahm es, das erkannte sie in den Briefen, offenbar auf die leichte Schulter. Weil sie aber nur Briefe schicken konnte, konnte Nina nur aufmuntern. „Über ernste Sachen reden, ihm mal den Kopf waschen, zur Vernunft bringen und so, das geht in Briefen ja nicht“, sagt Nina. „Wenn das deine einzige Möglichkeit ist, baust du eher auf, du ermunterst. Ein Brief ist ja kein echtes, intimes Gespräch.“

Marie und Chris
Chris ließ es nicht bleiben. Er bekam noch einmal neun und einmal sieben Monate obendrauf. Sie holten ihn wieder. Aber dieses Mal lagen die Dinge schwieriger: Chris Arbeit auf einer Baustelle war noch nicht fertig. Wer sorgte jetzt dafür, wer bezahlte die offenen Rechnungen? Marie musste sich kümmern. Ein Freund sprang ein, die Baustelle zu beenden, aber er pfuschte. Marie musste zwei Sparkonten auflösen, 3000 Euro, Chris brannte im Knast vor Wut, konnte aber nichts machen. Und Marie hatte das kleine Kind. „Ich bin fast verrückt geworden“, sagt sie.
Schließlich fand sie Rat im Internet. Es gibt viele Initiativen, die sich an Angehörige wenden, aber es gibt auch Hilfe in Form verschiedener Foren. „Ich habe glücklicherweise Leute gefunden, denen es ähnlich geht“, erzählt Marie. Oft hören Angehörige dann ja noch: Was willst du mit so einem Kerl, der ist nicht gut für dich, hast du etwa ein Helfersyndrom?
„Im Internet habe ich eine gute Freundin gefunden“, sagt Marie. „Dort konnte ich immer alles sagen, wir konnten unsere Sorgen und unseren Kummer teilen. Das hat mir sehr geholfen. Wir haben heute noch Kontakt.“
Die Zukunft
Leute, die über Frauen von Inhaftierten sagen, sie hätten ein Helfersyndrom, wissen oft nur die Hälfte. Natürlich gibt es auch das. Aber wenn man Marie und Nina fragt, warum sie das tun, würden sie sagen: Auch wir hätten es uns leichter machen können. Aber für die Liebe, meinen beide, gehst du halt durch das Feuer. „Wer würde das nicht tun, wenn er jemanden wirklich liebt?“, fragt Nina.
Nina und Marc haben letztes Jahr geheiratet. Marc ist frei und hat einen Job. Nina ist nicht mehr nur seine „Freundin“.
Chris sitzt noch anderthalb Jahre.
„Mein erster Besuch, das war erst letzten Monat“, sagt Marie. Elf Monate hat sie Chris insgesamt nicht gesehen. Normalerweise werden Häftlinge in der Nähe ihres Wohnortes inhaftiert, aber hier ging es um offene Verhandlungen. Sie brachten ihn, einige Tage nachdem sie ihn abgeholt hatten, zurück in sein Heimatbundesland, fünf Stunden Fahrt entfernt. „Wie sollte ich ihn da besuchen, mit Kleinkind?“, fragt Marie.
Wenn sie zu Besuch kommt, fühle sie sich fehl am Platz. „Mein Papa sagt immer: Da, wo Chris jetzt sitzt, sitzen nur die schweren Jungs“, sagt Marie. Vielleicht seien die Beamten deshalb eben sehr ruppig und haben nie ein freundliches Wort über, glaubt Marie.
Wenn sie im Besucherraum sitzt, versucht Marie nicht darüber nachzudenken, wer da noch alles sitzt. „Mir ist es nicht unangenehm, wenn meine anderthalbjährige Tochter zwischen den Stühlen und den Leuten da rumspringt“, sagt Marie. „Ich weiß, dass da Vergewaltiger sitzen und Mörder. Aber ich möchte einfach, dass meine Tochter ihren Vater sieht – und ich meinen Freund.“
Chris sitzt heute wieder in der Nähe seines Wohnortes.
Ob sie festgestellt habe, dass das Gefängnis Chris verändert habe?
„Nein“, sagt Marie. „Im Gegenteil. Aber ich habe mich verändert. Ich glaube, ich bin erwachsen geworden.“
*Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.



