- • Startseite
- • Horror-Nebenjob
-
•
Horror-Nebenjob: Telefonieren für Geld aber ohne Liebe
Manche Jobs sind schlimmer als andere – in dieser Serie erzählen wir von unseren und euren schrägsten Nebenjobs. Diese Geschichte hat unsere Autorin Magdalena erlebt und aufgeschrieben.
Mit der Arbeit ist wie mit der Liebe: Manchmal liegt es nicht am anderen, sondern man selbst ist das Problem in der Beziehung. Und manchmal ist eben nicht der Job schrecklich, sondern man selbst ist einfach nur furchtbar ungeeignet dafür. Also: Ungeduldige Personen sollten vielleicht nicht Vierjährige babysitten, und Menschen, die es eher ruhig mögen, sollten nicht als Wasserrutschen-Tester*in arbeiten. Und ich? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nicht im Telefon-Center arbeiten sollte.
Dabei klang der Job am Anfang so perfekt: Man geht in ein schickes Großraum-Büro, setzt sich ein Headset auf und öffnet ein Computerprogramm, das zufallsbasiert eine deutsche Nummer anwählt. Wenn eine Person rangeht, führt man eine Umfrage durch, etwa zu den Themen Rauchen, Autos, oder der Frage, welche Partei die angerufene Person wählen würde. Das Marktforschungsinstitut, für das man in diesem Büro telefoniert, ist angesehen und macht keine Werbung. Die Stunden sind flexibel, und man kann sich die Arbeitszeit selbst einteilen. Also eigentlich eine saubere Sache. Eigentlich.






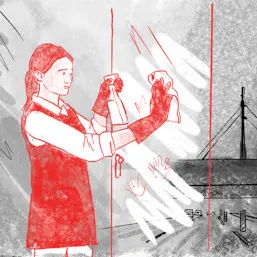




















Vielleicht hätte ich schon beim Bewerbungsgespräch misstrauisch werden sollen. Das hatte ich nämlich nicht alleine mit der Chef*in oder der Personaler*in. Nein, etwa zehn Bewerber*innen wurden gleichzeitig eingeladen, saßen zusammengequetscht in einem Büro und bekamen dort einen Vortrag über die vielen angeblichen Vorteile des Jobs zu hören. Und das war es dann auch schon. Mitten drin ich, 18 Jahre alt, und völlig verunsichert. Waren wir am Arbeitsmarkt so wenig wert, dass wir wie Nutzvieh durch die Gänge von Bürogebäuden getrieben werden konnten?
Ablehnungen sammeln, schlimmer als bei Tinder
Gleichzeitig dachte ich: egal. Dieser Job ist wie gemacht für mich. Die Bezahlung war mit 7,50 Euro (ja, damals gab es noch keinen Mindestlohn) zwar nicht gut, aber wenn man es schaffte, viele Telefon-Umfragen zu führen, bekam man Zuschläge. „Ich bin ja wohl ober-nett“, dachte ich, „wer würde nicht mit mir am Telefon quatschen wollen? Locker mache ich da zwölf Euro die Stunde.“ Dachte ich.
Ich habe knapp zwei Jahre für das Marktforschungsinstitut gearbeitet, Hunderte, wenn nicht Tausende Nummern gewählt. In diesen zwei Jahren hat sich nicht ein einziges Mal jemand über meinen Anruf gefreut. Ich habe mehr Ablehnungen bekommen als beim Tindern. Und natürlich verdiente ich auch nicht ein Mal zwölf Euro die Stunde.
Das durchschnittliche Gespräch lief so: „Halloooo, ich bin die Magdalena Pulz, ich arbeite für ein großes Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Hätten Sie vielleicht Zeit, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen, geht auch ganz schnell“, log ich, wohl wissend, dass die Umfrage auf jeden Fall länger als 15 Minuten dauert. Mensch am anderen Ende der Leitung: „Hahahaha, nein, ich bin gerade furchtbar im Stress und außerdem möchte ich nichts kaufen. Und woher haben Sie eigentlich meine Nummer???!“
„Bitte wählen Sie Option a,b oder c aus“
Wenn ich es doch einmal schaffte, eine gutmütige Person zu dem anonymisierten Interview zu überreden, wurde es erst richtig unangenehm. Dann musste ich nämlich den Fragebogen vorlesen, Wort für Wort. Ich durfte nicht davon abweichen, und vor allem durfte ich keine Fragen erklären. Das macht theoretisch Sinn, weil man so die Menschen nicht in ihrer Meinung beeinflussen kann. Praktisch aber brachte es meine Telefon-Partner*innen zur absoluten Weißglut, dass ich auf ihr Unverständnis immer nur wie ein Roboter den folgenden Satz wiederholte: „Das kann ich Ihnen leider nicht genauer sagen, bitte wählen Sie Option a,b oder c aus.“ Regelmäßig brachen Menschen deswegen die Umfrage erzürnt ab und legten einfach auf. Für mich bedeutete das: Kein vollendetes Interview, kein Aufschlag auf mein Stundengehalt.
Ich habe es gehasst: Dass ich nie wusste, bei was für einer Person mein Zufallsgenerator mich diesmal ausspucken würde. Dass ich so freundlich und nett sein konnte, wie ich wollte, und mich trotzdem alle am anderen Ende der Leitung wahnsinnig nervig fanden. Dass ich mit den Anrufen wirklich oft Leute in ihrer Privatsphäre gestört habe. Dass die Fragebögen so kompliziert und lange waren. Dass es in dem Büro Aufsichtskräfte gab, die ab und an unangekündigt eine Qualitätskontrolle machten, also die Telefonate mithörten. Und natürlich, dass gefühlt all meine Kolleg*innen in dem Großraum-Büro wesentlich erfolgreicher darin waren, Menschen dazu zu überreden, mit ihnen zu sprechen. Denn wenig macht einen Job ätzender, als sich die ganze Zeit wie eine Total-Versagerin zu fühlen.
Zusammengefasst, so lächerlich es klingt, mein Fell war wohl nicht dick genug für diese Art von Job. Weder konnte ich mit der konstanten Abweisung umgehen, noch habe ich damals verstanden, dass meine großkotzigen, oft männlichen Kollegen vielleicht gar nicht wirklich effektiver arbeiteten als ich, sondern einfach jedes von Erfolg gekrönte Telefonat lautstark abfeierten.
Heute bin ich Journalistin. Da fühle ich mich nicht mehr die ganze Zeit wie eine Total-Versagerin. Aber ich muss trotzdem noch manchmal Leute anrufen und ihnen unangenehme Fragen stellen. Und jedes Mal, wenn ich kurz zögere, jemanden anzurufen, denke ich mir:
„Wenigstens muss ich die Person jetzt nicht zu einer Umfrage überreden.“
Und dann wählt sich die Nummer schon viel leichter.

