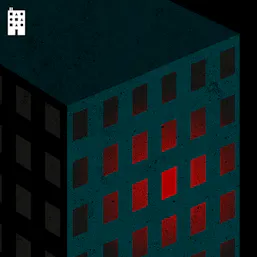- • Startseite
- • Gutes Leben
-
•
Sozialphobie: Soll ich mich den neuen Nachbarn vorstellen oder lieber nicht?
Lebensaufgabe Sozialkompetenz! So wichtig wie Wasser und Brot, so kompliziert wie eine Operation am offenen Herzen. In der Serie "Hilfe, Menschen!" berichten wir ab sofort von unseren Sozialphobien. Folge 4: Vorstellen oder verharren?
Ein Aufbruch in eine lichte Zukunft – das ist es, was ein Umzug verheißt. Egal, ob wir freiwillig gegangen, vor einer schimmeligen Zimmerdecke geflohen oder genervt von unserem Umfeld sind, hier fängt etwas an. Ein neues Leben. Und neue Leute gibt’s gratis dazu. Sie wohnen rechter- und linkerhand, ober- und unterhalb. Unsere Nachbar*innen. Ab jetzt werden wir eine Menge miteinander teilen. Treppe und Mülltonnen sowieso, aber auch Küchengerüche, Lustschreie und musikalische Obsessionen. Zuweilen sind wir sogar aufeinander angewiesen. Wo wären wir ohne Zucker-Eier-Knoblauch-Leihgaben und Urlaubs-Pflanzenpflegedienst? Wir wären am Arsch.
Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis, so habe ich es als Kind von meinen Eltern gelernt, beginnt am besten schon vor dem Einzug. Als wir damals unser lang ersehntes Eigenheim in der Vorstadt bezogen, bauten wir uns anmutig lächelnd vor nachbarschaftlichen Türen auf, schüttelten Hände und baten höflichst um Entschuldigung dafür, dass der Umzugslaster nächste Woche die Straße blockieren würde. Als der Laster wieder weg war, klingelte es bei uns. Irgendwer brachte Sekt zum Anstoßen mit, jemand anderes eine Salzbrezel mit der Aufschrift „Brot und Salz, Gott erhalt's“. Wir hatten alles richtig gemacht. Die Vorstadt hatte uns aufgenommen.
Folgerichtig schnappte ich mir Jahre später meinen Freund, der mein erster Mitbewohner werden sollte, und machte mich daran, in der neuen, großen Stadt an fremden Türen zu klingeln. Sekt auf gute Nachbarschaft wollten wir schließlich auch. Doch dann: Über uns war niemand zu Hause. Unter uns wummerte der Bass so bestialisch, dass die Klingel nur stummer Zeuge unseres guten Willens blieb. Nur in einer einzigen Tür zeigten sich widerwillig Knitterfalten, Bart und Trainigshose. Wir sagten unseren Text auf. „Un wat wollten Se nochmal jenau?“, fragte das Knittergesicht. „Na, uns vorstellen“, sagten wir. „Ach. Dat hätten wa ja jetz.“ Mit diesen Worten fiel die Tür ins Schloss. Den Sekt kauften wir uns dann selber.
Großstadt ist nicht gleich Vorstadt. Das verstand ich, als ich nur wenige Monate später die neue Wohnung verließ, weil das mit meinem Freund doch keine besonders gute Idee gewesen war. Und als ich danach weiterhin viele Stadtteile, Mitbewohner und Lebensentwürfe anprobierte und wieder verwarf, weil sie einfach nicht passten. Bei jedem einzelnen dieser Umzüge fragte ich mich, ob ich mich nicht bei meinen Nachbar*innen vorstellen müsste. Oder ob ich ihnen damit wieder nur auf die Nerven gehen würde. Es stellte sich heraus: Ob ich es tat oder nicht, niemanden kümmerte es in der Großstadt. Ich kam und ging, und mit mir Millionen andere. Wen wundert es da noch, dass die Nachbar*innen sich nicht für uns interessieren? Wir sind übermorgen doch eh wieder weg. Außerdem gibt es in der Stadt genug Zerstreuung (oder wie meine Mutter es ausdrücken würde: Anlässe zur Selbstzerstörung), sodass man getrost auf die semi-aufregende Neuigkeit von Frischfleisch im Haus scheißen kann.
Die besten nachbarschaftlichen Beziehungen, stellte ich fest, macht man ohnehin zufällig
Auch ich interessiere mich inzwischen nicht mehr sonderlich für meine Nachbar*innen. Es sei denn, sie sind männlich, gut proportioniert und haben einen leichten Bartschatten. Aber diesen Gefallen hat sich das
Universum bisher verkniffen. Überhaupt hat in all den Jahren noch nie jemand bei mir geklingelt, um sich vorzustellen. Nicht einmal eine schlecht proportionierte Frau ohne Bart. Da hab ich's dann auch sein gelassen.
Die besten nachbarschaftlichen Beziehungen, stellte ich fest, macht man ohnehin zufällig. Wenn man Grasdämpfe aufsteigen riecht und sich unversehens auf dem Balkon eine Etage tiefer wiederfindet. Wenn man sich ausgesperrt hat und der brummige Rentner von nebenan eine Teleskopleiter hervorzaubert, um sie todesmutig zu erklimmen. Wenn man mit Klopapier zwischen den Beinen verzweifelt hofft, dass sich die Grauhaarige von nebenan noch nicht in der Menopause befindet. Wenn man nachts im Treppenhaus auf eine weitere Feierleiche trifft, der man einen dreifachen Espresso kocht. Am nächsten Tag ist immer alles beim Alten. Man brummt sich gegenseitig irgendetwas zu, das wie ein „Hallo“ klingen könnte. Vielleicht aber auch wie „Halt's Maul“. Je nach Kontext halt. Aber man weiß, man kann aufeinander zählen. Und sich auch mal den Briefkastenschlüssel anvertrauen.
Kann man es denn niemandem recht machen?
Neulich zog ich in eine recht bürgerliche Gegend, die Vorstadt der Großstadt sozusagen. Meiner Gewohnheit entsprechend ging ich niemandem mit unverlangten Besuchen auf den Sack. Doch zwei Tage nach dem Umzug kreuzte sich mein Weg zur Mülltonne mit dem einer wohlfrisierten Dame. „Sie sind also die neuen Mieter?“, fragte sie. „Es wäre schön gewesen, davon nicht erst zu erfahren, wenn Sie ihren Müll in die selbe Tonne werfen wie ich.“
Erst wollte ich zurückpampen. Kann man es denn niemandem recht machen? Die einen fühlen sich belästigt, wenn man bei ihnen ohne echten Grund und unangemeldet vor der Tür steht, die anderen wollen alles ganz genau und am besten schon vorgestern wissen. Doch dann spürte ich die Sehnsucht nach vorstädtischer Ordnung in dieser sonst so komplizierten Welt. Und gab ihr nach. Ich nahm die Dame mit nach oben und kochte ihr Kaffee, wie man das eben so macht. Eine ganze halbe Stunde lang quälten wir gegenseitig mit Gesprächsversuchen. Ehrlich, ich hab' alles versucht und trotzdem weiß bis heute nicht, wer von uns beiden mehr Erleichterung verspürte, als sie wieder los musste. Oder ob sie überhaupt musste. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich sie weder jemals aus ihrem Rausch reißen noch nach einem Tampon fragen werde. Weil die Ordnung der Vorstadt solche Menschlichkeiten nicht vorsieht.
Es wird mal wieder Zeit für einen Aufbruch in eine neue, lichte Zukunft. Eine Zukunft, in der man sich in Ruhe lässt.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Text wurde zum ersten Mal am 12.09.2017 veröffentlicht und am 06.09.2020 noch einmal aktualisiert.