- • Startseite
- • Gender
-
•
Pride Month: Benno Gammerls Buch „anders fühlen“ über die Emotionsgeschichte Homosexueller in der BRD
„Heute werden die CSD-Paraden bejubelt, aber damals wurden die Teilnehmer*innen noch bespuckt“

Man kann die Geschichte homosexueller Menschen und ihres Kampfes für Gleichberechtigung in (West-)Deutschland anhand von Daten erzählen: 1969 wurde einvernehmlicher Sex zwischen erwachsenen Männern entkriminalisiert, 2001 wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt, 2017 die „Ehe für alle“. Der Historiker Benno Gammerl hat sich für einen anderen Weg entschieden: Er erzählt diese Geschichte auf Basis von Emotionen. Was und wie haben schwule und lesbische Menschen wann gefühlt? Was haben diese Gefühle individuell und politisch bewirkt? Gammerl ist Experte für „Emotionsgeschichte”, einem noch recht jungen Feld der Geschichtswissenschaft, und analysiert in seinem Buch „anders fühlen“ die Emotionsgeschichte schwulen und lesbischen Lebens in der Bundesrepublik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart. Dafür hat er Männer und Frauen unterschiedlicher Generationen zu ihren Erfahrungen befragt. Zum Pride Month haben wir mit ihm über seine Recherche, Protest und Politik und natürlich über Gefühle gesprochen.
jetzt: Der Titel Ihres Buches lautet „anders fühlen“. Aber homosexuelle Menschen fühlen doch nicht anders als heterosexuelle?
Benno Gammerl: Eben doch. Gefühle haben immer auch damit zu tun, wie die Fühlenden sich in der Gesellschaft positionieren und positioniert werden. Wenn ich mich als männlicher Teenager in ein Mädchen verliebe, habe ich zahlreiche Vorbilder in der Popkultur, im Elternhaus, um mich herum – wenn ich mich in einen Jungen verliebe, ist das anders. Der Titel soll aber auch zeigen, dass es mir nicht darum geht, Hierarchien zu konstruieren, sondern darum, Unterschiede zu betonen, ohne zu werten. Das Wörtchen „anders“ meint darum eine gelassene Form der Differenz.

Benno Gammerl lehrt seit 2021 als Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und gilt als führend in der Erforschung von queerem Leben in Deutschland.
Sie haben es gerade schon angesprochen: Die Grundthese des Buchs ist, dass individuelle Gefühle und der aktuelle Zustand einer Gesellschaft nicht voneinander zu trennen sind.
Das ist doch offensichtlich! Es gibt klare gesellschaftliche Vorstellungen davon, welches emotionale Verhalten in welcher Situation angebracht ist: Man lacht nicht auf einer Beerdigung, man weint nicht in der Disco. Auch in der Sexualität gibt es solche festgelegten Muster. Gefühle haben also mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, gehen aber nicht darin auf.
Wie meinen Sie das?
Die Gesellschaft gibt Möglichkeit A, B und C vor, aber damit ist das emotionale Spektrum noch nicht ausgeschöpft. Darum finde ich eine emotionshistorische Betrachtung der Homosexualität so spannend: In allen Erzählungen meiner Gesprächspartner*innen taucht dieser Moment auf, in dem sie etwas empfunden haben, für das sie keine Worte hatten. Weil sie sich als Frau zu einer anderen Frau, als Mann zu einem Mann hingezogen gefühlt haben. Weil es dafür bei den von der Gesellschaft vorgegebenen emotionalen Mustern keine Entsprechung gab, fingen sie an zu suchen, und haben Wege gefunden, dem eigenen Fühlen eine Bahn zu eröffnen.
Es gibt verschiedene Gefühle, die Sie immer wieder zur Sprache bringen, weil sie für die Geschichte der Homosexuellen in Deutschland wichtig waren und sind. Ich nennen ihnen jetzt mal jeweils eins und Sie sagen mir, welche Bedeutung es in diesem Kontext hat, okay?
Das können wir gerne mal ausprobieren.
„Viele würden Wut als negatives Gefühl beschreiben, aber in der Geschichte der Homosexualitäten war sie oft politisch fruchtbar“
Als erstes habe ich mir notiert: die Scham.
Die gilt als das Gefühl, von dem sich die Schwulen und Lesben befreit haben. Vor allem in den Nachkriegsdekaden wollten Menschen nicht gesehen werden, wenn sie in eine Homo-Bar gingen, als Frau mit einer Frau intim wurden oder auch nur zusammen wohnten. In den Siebzigern wurde dann auf Demos und schwul-lesbischen Veranstaltungen „trainiert“, die Scham zu überwinden und sich zu trauen, sich zu zeigen.
Zweites Gefühl: der Stolz.
„From shame to pride“: Das ist der Klassiker der emotionshistorischen Variante der queeren Geschichte. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Beim deutschen Begriff „Stolz“ kommt hinzu, dass er oft negativ konnotiert ist. Darum sagt man im Deutschen auch „gay pride“ – kein Mensch würde „schwuler Stolz“ sagen. Das Wort „Stolz“ tauchte in den Gesprächen, die ich geführt habe, generell so gut wie nie auf.
Da war eher vom „Selbstbewusstsein“ die Rede, oder?
Genau. Das Selbstbewusstsein zu haben, sich in bestimmten Situationen hinzustellen und zu sagen: „Ich bin schwul.“ Sich zu wehren, wenn jemand sich homophob äußert. Daran haben die emanzipatorischen Bewegungen der Siebziger sehr stark und erfolgreich gearbeitet. Heute werden die CSD-Paraden bejubelt, aber damals wurden die Teilnehmer*innen noch bedroht und bespuckt. Umgeben von der feindlichen Umwelt hat sich ein Gruppen-Selbstbewusstsein entwickelt, das auch politisch enorm wichtig war.
Gefühl Nummer drei: die Angst.
Eines der prominentesten Gefühle. Vor allem in den Nachkriegsjahren hatten die Menschen Angst, vor der Polizeirazzia, von den eigenen Eltern. Ein Gesprächspartner sagte, wenn er Sex mit anderen Männer hatte, hat er sich danach mehrfach gewaschen, weil er Angst hatte, dass der Geruch an ihm haftet. Durch die Gruppendynamik und das Wissen, nicht alleine zu sein, verändert sich die Angst später zwar, aber sie ist nicht verschwunden. Man fand nur neue Wege, damit umzugehen, vielleicht sogar mit ihr zu leben.
Die Wut.
Viele würden Wut als negatives Gefühl beschreiben, aber in der Geschichte der Homosexualitäten war sie oft positiv, politisch fruchtbar und produktiv. Gerade die lesbisch-feministische Bewegung hat extrem viel aus der Wut herausgeholt.
Ein Gefühl noch, weil es ein besonders schönes ist: die Liebe.
Die Geschichte in meinem Buch ist, dass das Verlieben, vor allem in den Nachkriegsjahren, meist sehr plötzlich passiert ist. Weil es wenig Orte und Zeiten gab, an und in denen man mit Personen des gleichen Geschlechts intim werden konnte. Ein Beispiel ist eine Frau, die einen Abend mit ihrem Mann und einem befreundeten Paar verbrachte. Als beide Männer betrunken in den Sesseln geschlafen haben, haben die Ehefrauen sich auf dem Sofa geküsst. Später, als es mehr Räume und Möglichkeiten für Homosexuelle gab, kam die Liebe dann oft allmählicher zustande.
„Wenn Fühlen generell gut war, konnte natürlich auch das gleichgeschlechtliche Fühlen nicht mehr schlecht sein“
Sie teilen ihr Buch in drei Phasen auf. Die erste, die Fünfziger- und Sechzigerjahre, überschreiben Sie mit dem Begriff „Ausweichen“. Damals war Sex zwischen Männer noch strafrechtlich verboten und Homosexualität galt als Krankheit. Welche Freiräume haben die Menschen sich trotzdem erkämpft?
Es gab Zeitschriften, aber es drohte immer die Zensur. Es gab Lokale mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen: Vorhänge an den Fenstern, man musste klingeln, um reinzukommen. Auch sie waren immer bedroht, denn wenn die Polizei Männer beim Paartanz erwischt hat, war die Schanklizenz schnell entzogen. Schwieriger ist es, etwas über die Freiräume zu erfahren, die sich lesbische Frauen erarbeitet haben. Alleinstehende Frauen hatten ökonomisch sehr zu kämpfen, der Druck zu heiraten, war für sie also definitiv größer. Es gab auch viel weniger Szene-Orte für Lesben, darum nimmt man an, dass Vieles privat passiert ist.
Gab es auch politischen Aktivismus?
Organisationen und Lobbygruppen haben auch damals schon bei Politiker*innen für die Entkriminalisierung der Homosexualität geworben. Sie sind sehr vorsichtig vorgegangen und immer ordentlich mit Schlips und Kragen aufgetreten. Ihr Engagement war aber sehr erfolgreich, denn 1969 wurde einvernehmlicher Sex zwischen erwachsenen Männern straffrei.
In den Siebzigern, der Phase, die Sie „Aufbrechen!“ nennen, hat sich das Engagement verändert: Statt mit Schlips und Kragen kam es laut, bunt und provokant daher.
Die Ansage war: „Wir verbiegen uns nicht mehr, damit ihr uns akzeptiert, sondern wir zeigen uns so, wie wir sind, und es ist eure Aufgabe als Gesellschaft, damit umzugehen.“
In den Siebzigern wurde generell mehr Gefühl gezeigt, die jüngere Generation hat sich damit von der eher gefühlskalten Elterngeneration abgegrenzt. Was hat das für die Schwulen- und Lesben-Bewegung bedeutet?
Dass es jetzt als schlecht galt, Gefühle zu unterdrücken, passte sehr gut zu ihrem Impetus – denn wenn Fühlen generell gut war, konnte natürlich auch das gleichgeschlechtliche Fühlen nicht mehr schlecht sein. Und es führte zu einem kollektiven politischen Moment, weil ja auch die Wut zugelassen wurde.
Die dritte Phase, ab den Achtzigern bis in die Gegenwart, nennen Sie: „Ankommen?“ Warum das Fragezeichen?
Einerseits, weil homosexuelles Begehren zunehmend normalisiert wird, das aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass die Stigmatisierung endet. Andererseits, weil es durch die Normalisierung auch zu neuen Problemen kommt, zum Beispiel zu einem gewissen Optimierungsdruck. Früher konnte man sagen: „Wenn ich als schwuler Mann daran scheitere, glücklich zu werden, liegt das an der gesellschaftlichen Diskriminierung.” Dieses Argument gilt immer weniger und man muss es sich selbst vorwerfen, wenn man scheitert.
Die Achtziger verbinde ich eigentlich eher mit einem Backlash, weil die Aids-Pandemie begann und schwule Männer extrem stigmatisiert wurden.
In den Achtzigern fanden Stigmatisierung, Emanzipation und Normalisierung parallel statt. Es gab die ersten homosexuellen Paare im Fernsehen und immer mehr schwul-lesbische Zentren, aber auch die Diskriminierung im Kontext von HIV und Aids, als schwulen Männern der Handschlag verweigert wurde. Gleichzeitig sorgte die Aids-Bewegung für einen neuen Schub der Emanzipation, mit großartigen Protestaktionen, durch die öffentlichkeitswirksam Politik gemacht wurde. Ein anderer Effekt von HIV war, dass sich Homosexuelle auf einmal Fragen stellten, die man auch im Rest der Bevölkerung kannte: Wer darf wen im Krankenhaus besuchen? Was ist mit dem Mietvertrag, wenn einer der beiden Partner stirbt? Was mit der Rente, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Und wie trauert man? Zwischen Trauer und Schwulsein wurde bis dahin nie ein Zusammenhang hergestellt.
„Heute gibt es mehr Vorbilder und mehr Wege in die schwul-lesbische Szene, online und offline“
Seit der Jahrtausendwende hat die gesellschaftliche Normalisierung der Homosexualität durch die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 2001 und der gleichgeschlechtlichen Ehe 2017 einen großen Schritt gemacht. Das wird aus der Bewegung heraus aber auch immer wieder kritisiert, oder?
Ja. Die einen sagen: „Endlich haben wir die Homo-Ehe, dafür haben war jahrzehntelang gekämpft!“ Und die anderen: „Das ist der Ausverkauf der radikalen Bewegung! Wenn ihr heiratet, seid ihr genau wie die Heteros und lasst euch von der gesellschaftlichen Mehrheit vereinnahmen.“
Wer hat Recht?
Ich finde: Es ist wichtig, weiterhin darüber zu streiten, ohne einer anderen Person das Recht auf ihre eigene Position abzusprechen, weil man sie für „zu radikal“ oder „zu angepasst“ hält. Leider passiert das immer wieder.
Mit Blick auf die Gegenwart: Was ist für junge, homosexuelle Menschen heute leichter als für frühere Generationen? Was schwieriger?
Leichter ist, dass es mehr Vorbilder und mehr Wege in die schwul-lesbische Szene gibt, online und offline. Durch das wichtige Antidiskriminierungsgesetz hat sich auch die rechtliche Lage nochmal verbessert. Schwieriger ist eventuell, dass das Angebot heute so groß ist, die Abkürzung LSBTI wurde und wird immer länger. Einerseits erhöht das die Chancen, den Platz zu finden, den man braucht – aber es kann auch schwieriger sein, ihn zu finden, weil die neue Vielfalt unübersichtlich sein kann. Man braucht eine gewisse Gelassenheit und innere Stärke, um auch mal sagen zu können: „Ich habe was ausprobiert, aber es war doch nicht das Richtige für mich.“ Wie Hildegard Knef gesungen hat: „Dann war’s eben Erfahrung anstatt Offenbarung.“
In der feministischen Bewegung wird oft kritisiert, dass die Jungen nicht genug zurückschauen. Wie ist das in der schwul-lesbischen Bewegung? Gibt es eine Verbindung und einen Austausch zwischen Jung und Alt?
Es gibt immer mehr Bewusstsein für das, was vorher war und aktuell vor allem ein wachsendes Interesse an der Aids-Protestbewegung. Ich glaube, es ist enorm wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen – aber ich würde nicht sagen, dass man „daraus lernen“ muss. Es gibt in der Szene zum Beispiel die Tendenz, die radikale Schwulen-Bewegung der Siebziger zur heroisieren. Klar hat die Großartiges erreicht, aber eben in ihrer Zeit. Deren politische Strategien eins zu eins aufs Jetzt zu übertragen, wäre falsch. Man sollte sich im Bewusstsein der eigenen historischen Situation mit der Geschichte auseinanderzusetzen und dann fragen: „Wie kann ich das ins Heute übersetzen?“ Deswegen ist es wichtig, die Erinnerung nicht nur aufzubewahren, sondern auch auszustellen. Ich wäre sehr froh, wenn mein Buch ein bisschen dazu beitragen kann.
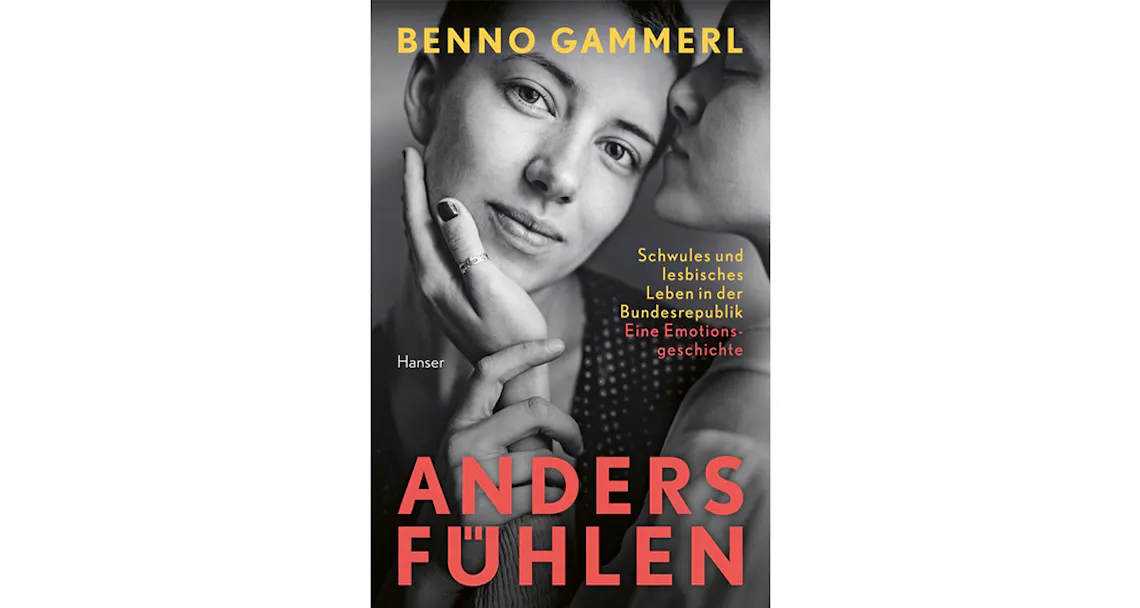
Benno Gammerl: anders fühlen. Schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik. Eine Emotionsgeschichte, Hanser, März 2021, 416 S., 25 €.


