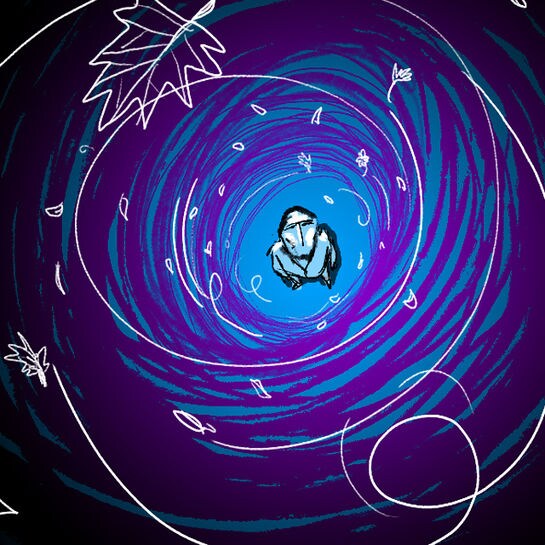- • Startseite
- • Gender
-
•
Warum die Corona-Krise die LGBTQ-Community besonders trifft
Eigentlich hätte Hannes Streit Ende März seine zweite geschlechtsangleichende Operation gehabt. Der 20-Jährige ist trans. Seine Gebärmutter, Eierstöcke und Scheidenhaut wären bei dieser Operation entfernt worden, seine Scheide verschlossen, ein Penis geformt. Dann kam Corona und damit die Anweisung, alle planbaren, medizinisch nicht notwendigen Operationen zu verschieben. Das beeinflusst auch Hannes’ Leben immens. Im Juli soll er eigentlich eine neue Stelle im Rettungsdienst antreten. Ob das klappt, weiß er nicht, denn nach der Operation darf er sechs Wochen nichts Schweres heben – und niemand kann sagen, wann die Operation stattfinden wird.
Aus Hannes‘ Abi-Jahrgang machen die ersten schon ihren Bachelorabschluss; er will endlich anfangen zu studieren. Er wartet damit, bis sein Körper zu seiner Geschlechtsidentität passt, einigermaßen. In Deutschland wurden laut Statistischem Bundesamt 2018 gut 1800 geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt; geht man also weiterhin von fünf Operationen am Tag aus, wurden seit dem OP-Stopp am 16. März schon 200 Operationen verschoben. Offizielle Zahlen zu verschobenen OPs gibt es nicht, aber in ganz Deutschland dürften kaum noch welche durchgeführt werden, sagt Dr. Oliver Markovsky, der das Zentrum für Geschlechtsangleichende Chirurgie München leitet. Denn wenn es nicht gerade um die Behandlung von Komplikationen geht, gelten sie nicht als medizinisch dringlich und sind momentan kaum zu rechtfertigen sind. In Markovskys Zentrum jedenfalls finden derzeit keine Operationen mehr statt.
Einige queere Menschen leben nun mit Familienmitgliedern zusammen, die sie ablehnen oder misshandeln
Queere Menschen erleben in der Corona-Krise, was andere auch erleben, sagt Christopher Knoll, Diplom-Psychologe und fachlicher Leiter des Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrums Sub in München. Aber: „Sie erleben es aus einer verletzlichen Position heraus.“ Es gibt ein Wort, das bezeichnet, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsgruppe beeinflusst, wie man etwas erlebt oder wie man Benachteiligung erfährt: Intersektionalität. Manches trifft in der Corona-Krise nur die LGBTQ*-Community, anderes trifft sie härter – je nachdem, in welchen gesellschaftlichen Umständen sie leben.
Etwas, das queere Menschen härter treffen kann als andere, sind Ausgangs-, Kontakt- und Reisebeschränkungen. Manche haben Sorge, dass sie Familienmitglieder, die im Krankenhaus sind oder in anderen Ländern leben, nicht mehr sehen dürfen – weil Besuche und Grenzübertritte nur engen Angehörigen erlaubt sind, aber Regenbogenfamilien oft nicht anerkannt oder sogar kriminalisiert werden. Viele beschreiben ihre Ängste in den sozialen Medien.
Einige queere Menschen, vor allem in weniger liberalen Ländern, stecken nun fest mit Leuten, denen gegenüber sie nicht geoutet sind, sie leben mit Familienmitgliedern zusammen, die sie ablehnen oder misshandeln.
Mick hat bis vor Kurzem in Oxford studiert. Weil immer mehr Grenzen geschlossen und Flüge gestrichen wurden und er nicht als Ausländer in England festsitzen wollte, ist er in sein Heimatland Singapur zurückgekehrt. Dabei steckt er mitten in seiner Geschlechtsangleichung. Es ist für alle sichtbar, dass sich sein Körper verändert hat. „Es ist nicht wirklich eine Option, diese Identität zu verbergen, da physische Veränderungen offensichtlich sind“, schreibt er. „Da ist der Stress, sich nach drei Jahren relativer Ruhe und Zufriedenheit plötzlich mit einer feindseligen Gesellschaft konfrontiert zu sehen.“ In Singapur ist es möglich, sein Geschlecht angleichen zu lassen, dennoch ist das Land eher konservativ. Sex unter Männern ist strafbar, auch wenn er nicht mehr verfolgt wird. Psychiatrische Gutachten und Rezepte für Hormone zu bekommen, sei schwierig, sagt Mick. Einfach rausgehen und eine neue Klinik suchen, gehe ja nicht, selbst wenn es eine gibt.
Nicht einfach raus zu können, das ist auch für queere Geflüchtete schlimm. Sie werden schon lange zusammen mit denjenigen untergebracht, vor denen sie eigentlich geflohen sind. Ebenso lange ist das ist schon problematisch. Früher waren viele Geflüchtete dann eben den ganzen Tag unterwegs, das gehe jetzt nicht mehr, sagt Annika Prose-Görl. Sie berät Geflüchtete im Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum München. Mohamed Turay ist mit 15 aus Sierra Leone geflohen, weil er dort wegen seiner Homosexualität verfolgt worden war, seit einem knappen Jahr lebt er in Deutschland. Er hat Angst, sich in seiner Flüchtlingsunterkunft zu outen: „Manche sagen in der Küche schlechte Dinge über queere Menschen. Nur das Personal weiß Bescheid.“ Seine Freund*innen und seinen Freund konnte er erst wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht sehen; jetzt darf er die Unterkunft nicht verlassen, weil Mitbewohner an Covid-19 erkrankt sind.
Vielen queeren Menschen wie Mohamed fehlt nun die Ersatzfamilie, in der sie akzeptiert werden, wie sie sind. Wer irgendwann vom Land in die liberalere Stadt gezogen ist, ist nun schnell allein. Und diese Isolation kann psychische Erkrankungen verstärken – queere Menschen leiden laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts ohnehin häufiger an Depressionen, sind öfter suizidgefährdet. Nicht, weil Queer-sein und psychische Erkrankungen direkt zusammenhingen, sondern weil sie nach wie vor selbst in Ländern wie Deutschland Diskriminierung erfahren. Zwei US-amerikanischen Studien zufolge rauchen mehr queere Menschen und haben queere Männer ein erhöhtes Diabetes-Risiko, vermutlich aufgrund der Belastung, einer Minderheit anzugehören – beides Corona-Risikofaktoren. Außerdem ist der RKI-Studie zufolge die Gesundheitsversorgung nicht ausreichend an die Bedürfnisse queerer Menschen angepasst, häufig fehlt Fachwissen.
Auch die wirtschaftliche Situation könnte queere Menschen härter treffen
HIV-positive Menschen – davon sind Christopher Knoll zufolge in Deutschland drei Viertel schwule Männer – sind dagegen durch das Coronavirus nicht mehr bedroht als Menschen, die nicht HIV-positiv sind. Zumindest, wenn die Anzahl der Viren in ihrem Blut dank antiretroviraler Medikamente unter der Nachweisgrenze liegt. Allerdings, sagt Knoll, machten sich manche Sorgen, dass ihnen die lebenserhaltenden Medikamente ausgehen, in der Vergangenheit sei es schon zu Beschränkungen gekommen. Der HIV-positive Autor und Aktivist Mark S. King ärgert sich, wenn die Corona-Pandemie mit dem Aids-Ausbruch in den 1980er-Jahren verglichen wird, etwa, was Kontaktbeschränkungen und die Suche nach Medikamenten angeht: „Hört einfach auf. Niemand hat sich in den ersten Jahren der damaligen Pandemie um die Menschen gekümmert, die an AIDS starben“, schreibt er auf seinem Blog.
Dazu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten in der Corona-Krise, die queere Menschen härter treffen könnten. Insbesondere trans Menschen haben laut Knoll oft wirtschaftliche Probleme. Schwule Männer werden der RKI-Studie zufolge geringer entlohnt als heterosexuelle. Auch viele queere Organisationen belasten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus: Der Christopher Street Day kann in diesem Jahr vielerorts nicht wie geplant stattfinden. Und ohne CSD-Veranstaltungen fehlen Einnahmen. Paul Klammer ist Vorstandsmitglied von Slado, dem Dachverband der Schwulen-, Lesben-, Bisexuellen- und Transidentenvereine und -initiativen in Dortmund; er sagt: „Die LGBTQ-Community hat wenig eigene wirtschaftliche Ressourcen, auf die sie zurückgreifen kann.“ In den vergangenen Jahren habe sich eine zaghafte staatliche Unterstützungsstruktur herausgebildet, diese könne nun in Gefahr geraten. „Was die aktuellen Kontaktbeschränkungen für die wenigen verbliebenen Szene-Lokale bedeuten wird, mag ich mir heute nicht ausmalen.“
Die Corona-Krise zeigt deutlich, dass queere Menschen noch immer nicht gleichberechtigt sind
Julia Bomsdorf, Pressesprecherin der Lesbenberatungsstelle Letra in München, fürchtet, Belange der queeren Community könnten in einer wirtschaftlich angespannten Situation vorschnell als Luxusprobleme gesehen werden: „Wie werden Räume der Subkultur aussehen und erhalten bleiben, wenn die wirtschaftliche Lage kritisch ist? Was wird in einer finanziell kritischeren Situation als notwendig erachtet und finanziert?“
Und Paul Klammer treibt noch eine Sorge um: „Queere Menschen waren in der Vergangenheit häufig genug Opfer von Schuldzuweisungen. Noch richtet sich der Unmut meiner persönlichen Beobachtung nach – unberechtigterweise – wahlweise auf die Bundesregierung, Geflüchtete oder vermeintlich unwissende Mitmenschen. So was kann sich schnell ändern.“ Bislang haben einzelne strengreligiöse Führer behauptet, queere Menschen seien schuld an Corona; der schiitische Geistliche Muqtada Al-Sadr bezeichnete gleichgeschlechtliche Ehen als einen der Gründe für das Coronavirus. Der russisch-orthodoxe Erzbischof von Berlin und Deutschland, Metropolit Mark Arndt, deutet in einem Sendschreiben an, die Corona-Pandemie sei verursacht worden von Menschen, die „nicht den gottgegebenen Unterschied zwischen Männern und Frauen anerkennen“.
Gleichzeitig haben sich in den vergangenen Wochen neue Initiativen wie die Aktion „Queer Relief“ des Karada House in Berlin oder der „Hardship Fund“ der London Bi Pandas gegründet, die gezielt queere Menschen unterstützen. Es gibt Gutachter*innen und Amtsgerichte, die Telefontermine anbieten für trans Menschen, die ihren Namen und Personenstand ändern möchten. So zeigt die Corona-Krise deutlich, dass queere Menschen noch immer nicht gleichberechtigt sind. Viele von ihnen werden noch lange unter dem Virus und den Auswirkungen der Pandemie leiden.